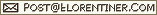- MMIV - MMXXV
- ♦ Alte Bergwerke zwischen Pr. Oldendorf und Porta Westfalica ♦
- SAXA LOQUUNTUR
Bergbau am Schwarzen Brink (Pr. Oldendorf)
Aktualisiert am 20.02.2012

Blick vom Schwarzen Brink in nördliche Richtung
In der Bezeichnung "Schwarzer Brink" ist ein kleiner Teil regionaler Bergbaugeschichte hinterlegt. "Kohlefunde" gaben dieser Erhebung ihren Namen, und nicht nur namentlich ist etwas erhalten geblieben: Spuren der Schächte und Stollen, die dort einst ins Wiehengebirge gehauen wurden, sind die sichtbaren Überbleibsel dieser Bergwerke. Sie gehören zu den ältesten nahe Pr. Oldendorf.
A

Aus der Aufnahme von Schlunck. Große Teile des Schwarzen Brinks werden in einer Zeit nach den hier geschilderten Abbauen zum Grubenfeld "Rudolf 2" gehören. Die Stollen der Amalia gehören nicht zum Schwarzen Brink und werden gesondert behandelt.
Während die Gesteinsschichten nach Norden einfielen, fiel das, was man für ein Kohleflöz hielt, mal nach Norden und mal nach Süden ein; mal verhielt es sich tatsächlich wie ein Flöz....um dann aber plötzlich wieder zu vertauben. Der Lagerung des Impsonits wegen war ein Abbau schwierig und unökonomisch. Immer wieder musste man die Lagerstätte "wiederfinden", nachdem sie vertaubte. Weder konnte man sich an der Stratigraphie orientieren noch an benachbarten Lagerstätten.

Am Schwarzen Brink
Weiterhin besteht auch die Möglichkeit, daß es -in sehr engen Grenzen- Überschneidungen mit der "echten" alochthonen Jurakohle gab, die vom Nonnenstein her bekannt ist. Bei den früheren Versuchen, die Entstehung der "Kohle" zu erklären, wurde viel spekuliert, so wurde zum Beispiel eine "Einschwemmung von Wealdenkohle in offene Spalten bei Aufformung des Gebirges" in Betracht gezogen, so z. B. von Dienemann im Erläuterungstext zu den geologischen Karte der Blätter Melle, Quernheim u. Oeynhausen. Klarheit gab es erst in der jüngeren Vergangenheit bei einer genaueren und intensiveren Untersuchung der Wiehengebirgsflexur, des Limbergsattels und seiner Umgebung. Bei der Genese des Impsonits spielte wieder einmal der Bramscher Intrusiv mit seiner Hitzeeinwirkung eine große Rolle.
Wallringpingen entstehen, wenn unterirdische Hohlräume
dem Gebirgsdruck nachgeben und einstürzen. Durch mechanische
Vorgänge (Pressungen, Hebungen u. Schichtenzerrungen)
bildet sich machnmal ein Wall um die Pinge.
Die Spuren der alten Bergwerke am Schwarzen Brink
Folgt man dem Waldweg, welcher sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Parkplatzes am hölzernen Wiehenturm befindet in westliche Richtung, so steuert man geradewegs auf den Schwarzen Brink zu. Die oberflächennahen Schichten am Schwarzen Brink zählen zum oberen Jura, am Nordhang lassen sich noch kleine Aufschlüsse finden. Lt. Lohmann stehen am Nordrand des Schwarzen Brinks auch Schichten des unteren weißen Jura an, damit existiert mithin eine (sehr theoretische) Möglichkeit, daß dort ebenfalls die bereits vom Nonnenstein her bekannte alochthone Jurakohle des Wiehengebirgsquarzits abgebaut worden sein könnte, Hinweise darauf gibt es allerdings bislang nicht. Die Geschichte der ersten Gruben am schwarzen Brink ist nicht eindeutig, erst zu den späteren Abbauen gibt es Hinweise: Im Jahre 1799 beschloß man, einige alte Grubenbaue am Schwarzen Brink wieder aufzuwältigen und eröffnete damit die mindestens zweite Abbauperiode. In einem 15 m tiefen Schacht fand man die beschriebene kohleartige Substanz. Mittels eines Stollens wurde versucht, einbrechendes Wasser zu lösen. Warum der Stollen zum Lösen des Grubenwassers relativ weit vom Schacht entfernt angefahren wurde, geht aus den überlieferten Daten nicht hervor, eventuell ging man noch von einer weitaus ergiebigeren Lagerstätte aus.
Diese Pinge dient als Sammelstelle für Forstabfälle. Anderenorts
haben Pingen den Status eines Denkmals.

Nur wenige Meter entfernt: Eine beiwerklose Pinge

In eine der Pingen mündet diese grabenartige Vertiefung.
Sie verläuft quer zum Streichen der Schichten.
Noch etwas ausser Impsonit?
Einer 150 Jahre alten Arbeit (Klipstein) kann man entnehmen, daß es evtl. auch Abbaue auf Eisenstein am Schwarzen Brink gegeben haben mag. Leider sind nicht mehr alle Ortsbezeichnungen aus dieser Arbeit nachvollziehbar, einige beschriebene Stollen dürften aber nahe oder gar im Schwarzen Brink zu suchen sein. Ausgehend von den Abbauen am Dörrel, nördlich des Schwarzen Brinks, begab sich Klipstein zu einem Abbau 200 Lachter in südöstliche Richtung, um zum Schluss einen Bergbau noch weiter südlich aufzusuchen. Dieser dürfte sich am Schwarzen Brink befunden haben. Ob es sich um einen anderen Abbau als den oben beschriebenen auf Kohle gehandelt hat, wäre noch zu klären.« Zurück
- Web-Design, CSS-Style, Texte & Grafiken: © Florentiner.com
- Best viewed with: Firefox and open eyes.